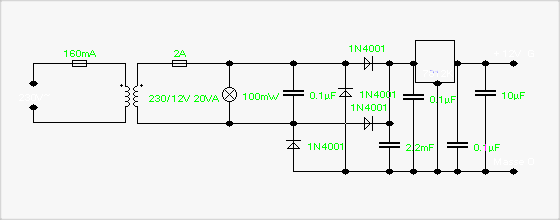|
Die eingesetzte Technik
Definitionen und Fakten |
 |
|
Spannungsversorgung allgemein: Beschreibung der Stromquellen
Hinweis:
Wenn andere als die vom Hersteller empfohlenen Trafos eingesetzt
werden sollen, ist zu beachten, daß auf der Primärseite stets die
lebensgefährliche Netzspannung von 230V~ anliegt; daher dürfen nur Experten, die
aufgrund ihrer Ausbildung dazu befugt sind, diese Geräte aufbauen und unter Beachtung
der Sicherheitsvorschriften in Betrieb nehmen!
Der Betrieb selbst ist nur im vollisolierten, geschlossenen Gehäuse zulässig.
(Und wenn Dir Dein Leben schon egal ist, dann denk wenigsten an die (Nachbars-) Kinder,
die die Bahn vielleicht mal sehen wollen, oder an den Putzteufel, der ausgerechnet "da
hinten" an den Klemmen mit dem nassen Lappen rumfummelt !!) |
| Weiterhin ist es aus Sicherheitsgründen unerläßlich, die
Stecker aller verwendeten Trafos über eine Steckerleiste oder Steckdosengruppe gleichzeitig
zu schalten und dafür Sorge zu tragen, daß niemals bei laufender Anlage einer Stecker gezogen
wird. Aufgrund der weiter unten erläuterten Problematik der Gesamtmasse
könnte sonst an diesem gezogenen Stecker lebensgefährliche Netzspannung von 230V~
anliegen !! |
Soweit das Wort zum Montag.
Zum Betrieb der Anlage erforderliche Spannungsquellen und deren Spezifikation:
- Die Anlage wird wahlweise konventionell oder digital betrieben. Analog bedeutet bei Märklin
die Einspeisung der Fahrspannung (Bahnstrom B, rot, 4 - 16V~, Fahrtrichtungswechsel mit
24V~ Überspannung) in die einzelnen Streckenabschnitte, wobei für unterschiedliche
Geschwindigkeiten an Berg- und Talstrecken jeweils eigene Trafos oder entsprechende Module
notwendig sind.
Digital bedeutet Einspeisung der Digitalspannung (Bahnstrom B, rot, 18V= in die gesamte
Anlage, wobei eine Trennung in verschiedene Stromkreise - u. U. mit eigenem Booster - keine
funktionelle Bedeutung hat, sondern nur kurzschlußtechnisch erforderlich ist.
- Magnetartikel werden über den Lichtstromanschluß L, gelb, (16V~) betrieben;
da über diesen Stromkreis keine Lampen betrieben werden (Weichen- und Signallaternen
sind generell getrennt), kann hier auch ein Block- oder Ringkerntrafo mit 18V/4A eingesetzt
werden, um etwas "müderen" Antrieben die erforderliche Power zu verleihen. Besonders in diesem
Fall ist die Überwachung der Magnetartikel wichtig, da ein Dauerbetrieb den Artikel unweigerlich zerstören wird!
Ebenfalls ist für einen hinreichenden Kurzschlußschutz zu sorgen - (Kabel-) Brandgefahr!
- Lampen und Beleuchtung L1, weiß bzw. grau, werden über einen 12V~
/100VA Halogentrafo betrieben; sie sind dadurch nicht so hell und leben wesentlich länger
als mit 16V; auch ist die Wärmeentwicklung deutlich geringer. Sehr wichtig ist hierbei
jedoch die Absicherung des Halogentrafos (der bringt nämlich locker 20A Kurzschlußstrom,
und die schmelzen in Sekundenschnelle ein Loch selbst in das Schotterbett der M-Gleise! -
da schützt auch der eventuell eingebaute Thermosschalter des Trafos nicht; bis der
auslöst, sind die Kabel verbrannt). Vogesehen ist hier die Trennung in fünf
Stromkreise, die mit je einer Schmelzsicherung 2At abgesichert sind; je Kreis können dann 20 bis
30 Lämpchen angeschlossen werden.
Der sekundäre Trafoausgang wird zusätzlich über eine 8A-KFZ Sicherung geführt,
um im den Kurzschlußfall sicher abzuschalten. Im Gegensatz zum Bahnstromkreis können und
dürfen im Lichtstromkreis keine betriebsbedingten Kurzschlüsse auftreten. [Wie wichtig die
Absicherung ist, hat mir Anfang Sept 98 ein Motorbrand in unserer 16 Jahre alten Waschmaschine gezeigt:
der Motor war gar nicht abgesichert, hat blockiert und hat dann für ein interessantes Programm im
Bullauge gesorgt.]
- Die Elektronikmodule werden z.T. mit einer zentralen Gleichspannung G, schwarz [i'm sooo sorry :)],
12V versorgt; diese wird aus einem 20VA Halogentrafo mit nachgeschaltetem 7812-Regler
gewonnen. Der Trafo ist schön klein und bietet hinreichend Reserven, der Regler gibt ja
nur maximal 1A ab; allerdings sollte auch hier eine Schmelzsicherung auf der Sekundärseite
und ein ausreichend großes Kühlblech für den Regler eingebaut werden.
Je nach Strombedarf werden mehrere Gleichstromkreise verwendet.
- Andere Module erzeugen sich die Betriebsspannung aus der Weichenspannung oder einer separaten,
potentialgetrennten Wechselspannung von 12V~. Da grundsätzlich eine gemeinsame Masse erforderlich ist,
kann im ersten Fall nur mit Einweggleichrichtung gearbeitet werden (so zB im Schattenbahnhof, Ub 21V-).
Im zweiten Fall werden aus den 12V~ unter Last 15V- erzeugt.
Aufgrund der vorgegebenen Struktur der Weichenrückmelde-Module erzeugen sich diese ihre eigene
Gleichspannung; sie brauchen eine höhere Spannung zur Einspeisung der Testsignale in die
Magnetspulen. Daher werden diese an einen separaten 16V~ Trafo angeschlossen, der sekundärseitig
keine Verbindung zur übrigen Elektrik haben darf.
Schaltungsvorschlag:
- Magnetartikel liegen prinzipiell stets an der Versorgungsspannung L, die Rückleitung wird gegen
Masse 0, blau geschaltet. Ein Dauerkontakt der blauen Leitungen mit Masse führt in der
Regel zur Überhitzung und Zerstörung des jeweiligen Magnetartikels. Man könnte alle
blauen Leitungen der Magnetarikel mittels einer LowCurrent Leuchtdiode mit Vorwiderstand
überwachen: solange die Diode leuchtet, ist der Artikel betriebsbereit.
Eine normale Leuchtdiode oder ein Lämpchen parallel zum Artikel würde jede Ansteuerung,
bei Dauerlicht einen Kurzschluß signalisieren.
Das Problem der Gesamtmasse
Das gemeinsame Potential aller Spannungsquellen ist die Masse 0, braun. Beim Zusammenschalten
der Masse der Wechselstromtrafos ist darauf zu achten, daß dies phasenrichtig erfolgt,
da ansonsten die Spannung zwischen zwei gleichnamigen Polen (z.B. L - L) nicht Null ist, sondern das
doppelte der Nennspannung beträgt!
Der Test erfolgt wie im den Märklinanleitungen beschrieben, indem die Massepole 0 direkt und
die Ausgänge B bei mittlerer Stellung des Fahrreglers über eine Glühlampe verbunden
werden; diese darf nicht leuchten! Wenn sie leuchtet, muß ein Netzstecker um 180°
gedreht werden.
Dieser Test ist mit jedem Trafo zu wiederholen.
Zur Vereinfachung ist es daher sinnvoll, alle Trafos über einen Hauptschalter aus- und einzuschalten.
Die Masse aller Stromquellen wird direkt miteinander verbunden, die erfolgt am sichersten über
eine braune Ringleitung mit ausreichendem Querschnitt, je nach Anlagengröße 0,5 bis
2,5mm2.
Eine direkte Verbindung der übrigen gleichnamigen Pole (L-L, B-B) verschiedener
Trafos/Spannungsquellen ist nicht zulässig, da zum einen durch die eventuellen
Ausgleichströme die Trafos belastet werden (Wärme, Kosten) und zum anderen beim Ziehen
des Netzsteckers eines AC-Trafos an diesem (durch Rückwärtsspeisung) die volle Netzspannung
anliegt: wer diesen vermeintlich lose herumliegenden Stecker anfasst, erhält einen lebensgefährlichen
Schlag!
Bei Digitalkreisen gilt dies sinngemäß. Dabei kommt es aber nur zur Vernichtung des aufwendig
erzeugten Digtalsignals, ein Rückspeisung kann hier nicht auftreten.
Die Versorgungstrafos der einzelnen Digitalkomponenten dürfen nicht untereinander verbunden
werden, da die Verbindung auf der Gleichstromseite erfolgt.
Wenn also alle Trafos phasenrichtig angeschlossen sind und es keine Verbindung ausser der
gemeinsamen Masseleitung gibt, so existiert auch kein Problem mit der Gesamtmasse. Man kann
hingegen sogar absolut sicher sein, daß gegenüber dem Gleispotential "0" keine höheren Spannungen
als die zu erwartendenen auftreten können.
Verbinden der Gesamtmasse mit dem Null- oder Erdpotential des Hauses.
Ganz alte Märklin Trafos (wie der Super 280) hatten eine dreipolige Zuleitung, bei der der
Schutzkontakt (N bzw. PE) auf eine seitliche Klemme am Trafo geführt wurde und somit mit der
Masse 0 der Gleisanlage verbunden werden konnte.
Dies ist heute nicht mehr erlaubt. Die Schutzklasse der Trafos erfordert die unbedingte Trennung
von Primär- und Sekundärseite, was durch die Verbindung der Gleismasse 0 mit dem Schutzleiter PE
aufgehoben würde, da PE spätestens im Zählerkasten mit dem "Rück"leiter N verbunden ist. Als
Folge erlischt die Betriebserlaubnis des Trafos.
Technisch gesehen spricht nichts gegen den Anschluß des Masse an den Schutzleiter, wenn ein
FI-Personenschutzschalter in dem Stromkreis vorhanden ist. Dies würde sogar verhindern, da
bei einem zugegebenermaßen unwahrscheinlichen Defekt in einem Trafo die Netzspannung unbemerkt
an den Gleisen anläge.
Verwendete Kabelfarben und Bezeichnungen
Übersicht
| Bezeichnung |
Symbol |
Farbe |
Spannung |
Hinweis |
| Bahnstrom | B | rot |
0 - 24V~ | Fahrspannung der Lokomotiven |
| Gleichstrom | G | schwarz |
12V= | Versorgung der Elektronikmodule |
| Lichtstrom | L1 | gelb |
16V~ | Versorgung der Magnetartikel |
| Lichtstrom | L2 | weiß |
12V~ | Versorgung der Laternen von Magnetartikeln |
| Lichtstrom | L3 | grau |
12V~ | Versorgung der übrigen Leuchtmittel |
| Masse | 0 | braun |
0V | Rückleitung von Bahn-, Licht- und Gleichstrom |
| Masse | 0 | blau |
0V | geschaltete Rückleitung von Magnetartikeln |
|
Ausführung der Verkabelung
Man kann grundsätzlich zwischen zwei verschiedenen Verkabelungstypen sowie beliebigen Mischformen
unterscheiden:
- Ringleitung
ausgehend von einem zentralen Speisepunkt wird ein hinreichend starkes Kabel unterhalb der
Gleisanlage so geführt, daß es letzlich wieder am Startpunkt endet, also einen mehr oder
weniger zerbeulten Ring bildet. Der Querschnitt muß so gewählt sein, daß selbst bei maximaler
Belastung nicht mehr als 1 Volt Spannungsunterschied in diesem Ring entstehen kann.
Für Licht- und Bahnstrom sollten also Querschnitt von 0,5 - 1,5mm2 ausreichend sein,
für die Masse 1,0 - 2,5mm2. Die Verlegung von Litze ist generell einfacher als von
(starrem) Draht, dieser ist jedoch formstabiler.
- Sternleitung
Jeder Verbraucher (Blockbereich, Gruppe von Weichen, Signalen oder Lampen) wird über eine
separate Leitung sternförmig zum zentralen Schalt- und Speisepunkt geführt.
Dies erhöht zwar die Zahl der Einzelleitungen erheblich, hat aber nicht zu unterschätzende
Vorteile - weiteres unten. Der Querschnitt dieser Zuleitungen reicht von der normalen
0,14mm2 Modellbahnlitze bis hin zu 0,5mm2 Schaltschranklitze für weite
Strecke und/oder größere Verbraucher.
Realisierung:
Es kommt eine Mischform zum Einsatz:
- Eine Hauptmasseleitung wird als Ringleitung unterhalb der Gleistrasse gezogen, der
Leitungsquerschnitt beträgt bis zu 0,75mm2. Alle braunen Kabel von den
Anschlußgleisen bzw. den Beleuchtungseinrichtungen werden direkt mit dieser Masseleitung
verbunden.
Dies entlastet zum einen das Gleismaterial von den Rückströmen, die im Fehlerfall oder bei
schlechten Schienenverbindungen Ursache für unangenehmene Potentialerhöhungen und somit einer
effektiven Spannungsverschiebung zwischen Schiene und Mittelleiter sein können. Folgen wären
neben Schwankungen in der Zugbeleuchtung eventuell auch Störungen im Digitalbereich, besonders
bei älteren Dekodern (zB. 6080)
- Die Gleisanlage wird in Blöcke aufgeteilt und jeder Block wird einzeln zum zentralen
Schaltpult durchverkabelt. Dies hat den unbestreitbaren Vorteil, daß bei einem eventuellen
Kurzschluß der betroffene Block durch Abschalten stromlos geschaltet werden kann und somit
der Betrieb auf der übrigen Anlage weiterlaufen kann.
Meist ist es ja gar nicht so einfach, den Kurzschluß zu finden: ein Schräubchen im
Schattenbereich, eine abgebrochene Schwelle, die normalerweise (bei K-Gleis) den Mittelleiter
von der Schiene trennt, eine kaum sichtbare Einzelader ...
Durch Abschalten und manuelles Wiedereinschalten der einzelnen Anschlüsse läßt sich der
gestörte Block schnell einkreisen.
Blöcke sind hier:
- Einzelene Gleise im Schattenbahnhof
- Der Ausfahrbereich bis zum ersten Streckensignal
- Der eigentliche Signalhalteblock
- Die Strecke bis zum nächsten Signal
- ... usw. bis
- Hinter dem letzten Streckensignal der Einfahrbereich zum Schattenbahnhof
- In Steigungsbereichen wird ein zusätzlicher Block eingefügt (Streckenlänge verkürzt)
- BW-Bereich
- Bahnhofsgleise
Bei Analogbetrieb können die Blöcke mit unterschiedlicchen Fahrspannungen versorgt werden, um
zB. sicherzustellen, daß
- der Güterzug die Rampe hoch kommt (höhere Spannung),
- der Schnellzug am Fuß der Rampe nicht aus der Kurve fliegt (geringere Spannung) und
- im Schattenbahnhof langsam (an-)gefahren wird.
- Die Magnetartikel ohne Rückmeldeelektronik können über eine Ringleitung (Litze 1,0 -
1,5mm2) versorgt werden.
Bei Einsatz der Rückmeldemodule empfiehlt sich der Einsatz von fertig konfektionierter 3poliger
Litze (blau blau gelb, zB. Brawa) oder selbst gebündelten Einzeladern von der Weiche/Signal direkt
zum Rückmeldemodul.
- Die Beleuchtung der Weichen- und Signallaternen erfolgt in Gruppen zusammengefasst (ca.
20 Lämpchen zu 0,05A) über 0,5mm2 Litze.
Gleiches gilt für Haus- und Straßenbeleuchtung: hier werden funktionelle Gruppen gebildet
(max. je 20 Brennstellen) und diese über 0,5mm 2 Litze zum entsprechenden Schaltpult
geführt.
- Die Elektronikmodule werden unter Berücksichtigung ihrer Stromaufnahme auf die Gleichstromquellen aufgeteilt, die Rückmeldemodule werden über einen potentialfreien 16V~ Trafo
versorgt.
Grundsätzlich wird in der unmittelbaren Nähe eines jeden Verbrauchers eine lösbare
Verbindung mittels Klemmblock / Lüsterklemme gesetzt, um im Fehlerfall die Spannungen einfacher
messen zu können und das Betriebsmittel leichter auswechseln zu können. Dieser Klemmblock
umfasst alle Anschlußleitungen des Betriebsmittels, diese werden ohne weitere Zugentlastung vom
Gerät zur Klemme verlegt.
Märklin Motoren
Konventionelle Märklinlokomotiven sind mit Reihenschlußmotoren ausgestattet und somit
Allstromloks.
Sie erzeugen sich unabhängig von der Stromart (Gleich- oder Wechselstrom) das zur Drehbewegung
des Motorankers erforderliche Magnetfeld selbst. Zur Drehrichtungsänderung wird das Feld
umgepolt; dies wird in der Praxis durch das Umschalten gegensinnig gewickelter Stator-Feldspulen
erreicht.
Es gibt inzwischen eine ganze Menge verschiedener Ausführungen dieser Motoren.
Ursprünglich wurden alle Loks mit einem Scheibenkollektormotor ausgerüstet
(FCM = Flat ComMutator), den es in drei Ausführungen gab (gibt):
SFCM (Small FCM) - Standardmodell
LFCM (Large FCM) - erhöhte Zugkraft, in Modellen wie 01, 44, V200, E94, ...
SLFCM (Superlarge FCM) - aus der Spur 0/1 Entwicklung, in den 50. Jahre in Modellen
wie Gußtriebwagen oder Krokodil eingesetzt
Ab den 70. Jahren wurde der Trommelkollektormotor eingeführt (DCM Drum
Commutator), hier wird vor allem zwischen drei- und fünfpoligen Anker unterschieden.
Insbesondere die fünfpoligen Anker (5-Stern-Antrieb) sind als Schnelläufer bekannt.
Vor- und Nachteile der diskreten Elektronik
Einige mögen sich an dieser Stelle fragen: "Warum setzt der noch eine so veraltete Technik
mit diskreten Transistoren, Dioden und vereinzelten CMOS-ICs ein?".
Die Antwort darauf ist zunächst relativ simpel: ich habe von dem Zeugs kistenweise
rumliegen; PICs, GALs oder Mikrocontroller müsste ich kaufen.
Weiterhin sind Modellbahner in aller Regel keine Elektronik- und Programmierprofis, so daß
der Nachbauanreiz bei einer hochintegrierten Schaltung mit CustomerICs schnell gegen Null geht.
(So geht es zumindest mir)
Bei Störungen läßt sich in der gewählten Bauweise problemlos das defekte
Bauteile wechseln; bei höher integrierten Bausteinen wechselt man dann statt der drei Pins
eines Transistors 16Pins (und 5 funktionierende Transistoren) des TreiberICs.
Die Stromversorgung gestaltet sich ebenfalls recht einfach; es genügt eine stabilisierte
12V/1A Versorgung für die Elektronik von etwa 10 Modulen.
Und letztlich möchte ich an der Schaltung nix verdienen, denn was wäre einfacher, als
die Diodenmatrix in ein GAL zu packen und dieses für 25,00EUR an Nachbau-Interessierte zu
verscherbeln?
Als Nachteil steht demgegenüber der (zahlenmäßig) hohe Bauteilaufwand, die
höhere Verlustleistung der gesamten Schaltung sowie die Platinengröße.

© 1997-2009 Klaus Ortwein -
KraKor
Letzte Aktualisierung: 12.10.02